Psychologische Sicherheit als Schlüssel für Transformation
Mut zur Veränderung

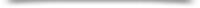
Geopolitische Krisen, hohe Unsicherheit und eine ungesunde
Psychologische Sicherheit – Schlüssel für Veränderung und Vertrauen
Wir alle kennen Situationen, in denen wir spüren: Jetzt wäre es wichtig, etwas zu sagen – aber lieber halte ich mich zurück.
Die Angst, sich zu blamieren, anzuecken oder Missfallen zu erzeugen, ist tief in unserer Arbeitswelt verankert. Genau hier beginnt das Thema psychologische Sicherheit.
Was bedeutet psychologische Sicherheit?
Auf individueller Ebene heißt sie: Ich darf Bedenken äußern, Fragen stellen, Fehler zugeben – ohne Angst vor Beschämung oder Abwertung. Ich vertraue darauf, dass meine Stimme zählt.
Amy Edmondson, Professorin an der Harvard Business School, beschreibt es so:
„Ein Team ist psychologisch sicher, wenn seine Mitglieder bereit sind, zwischenmenschliche Risiken einzugehen.“
Auf organisationaler Ebene ist psychologische Sicherheit ein unsichtbarer Erfolgsfaktor. Sie fördert Innovation, Lernfähigkeit und Transformation – vorausgesetzt, wir sind bereit, unter die Oberfläche zu schauen.
Warum Menschen Halt suchen
Je komplexer Organisationen werden, desto größer das Bedürfnis nach Orientierung.
In einem meiner Beratungsprozesse zeigte sich das deutlich: Zwischen Abteilungs- und Teamleitung war unklar, wer welche Entscheidungen trifft. Manche Mitarbeitende zogen sich zurück, andere fragten doppelt nach – aus purer Vorsicht.
Dieses Verhalten war kein Zufall, sondern Ausdruck eines kollektiven Sicherheitsbedürfnisses. Strukturelle Unklarheit erzeugte psychologische Unsicherheit.
Die Folgen sind typisch: Verantwortlichkeiten verschwimmen, Entscheidungen verzögern sich, und statt Bewegung entsteht Lähmung.
Fehlt Sicherheit in der formalen Struktur, übernehmen informelle Muster die Steuerung – meist auf Kosten von Vertrauen und Effizienz.
Warum Führungskräfte oft zögern
Führungskräfte wissen um die Bedeutung psychologischer Sicherheit – und doch fällt es vielen schwer, sie herzustellen.
Oft, weil unbewusste eigene Unsicherheiten im Spiel sind.
Wenn sich Rollen oder Machtverhältnisse verändern, tauchen Fragen auf, die tief an die berufliche Identität rühren
- Wer bin ich in diesem neuen Kontext?
- Worin liegt mein Beitrag?
- Was sichert meinen Einfluss?
In Übergangsphasen erlebe ich häufig, dass Führungskräfte an vertrauten Mustern festhalten, Konflikte vermeiden oder Kontrolle verstärken. Das gibt kurzfristig Stabilität – verhindert aber echte Offenheit.
Psychologische Sicherheit entsteht erst, wenn Rollen nicht nur formal benannt, sondern innerlich geklärt sind.
Wer seine eigene Rolle verstanden und gestaltet hat, kann Orientierung geben, Verantwortung teilen und zugleich präsent bleiben.
Oder, kurz gesagt:
Psychologische Sicherheit im Team beginnt mit der Selbstsicherheit der Führungskraft.
Welche Strukturen helfen
Sicherheit wächst nicht durch Appelle, sondern durch systematische Kulturarbeit.
In der Praxis bewähren sich fünf Ebenen:
- Haltung und Selbstreflexion stärken
- Strukturelle Voraussetzungen schaffen
- Kommunikationskultur verändern
- Fehlerreflexion methodisch etablieren
- Verantwortung nachhaltig sichern
Praktische Formate wie ein „Fehler des Monats“, Lern-Tandems oder kollegiale Reflexionsrunden erzeugen korrigierende emotionale Erfahrungen: Führung wird nahbar, Lernen wird selbstverständlich.
Wenn Führungskräfte eigene Fehler offen ansprechen, durchbrechen sie unbewusste Perfektionsmuster und öffnen den Raum für Vertrauen.
Der organisationale Blick: Sicherheit als emotionaler Container
Auf organisationaler Ebene wirkt psychologische Sicherheit wie ein emotionaler Container – ein Raum, in dem Unsicherheit, Widersprüche und Veränderungsdruck gehalten werden können.
Teams, die Risiken eingehen dürfen, bringen neue Ideen ein, stellen Bestehendes infrage und tragen so zur Entwicklung der Organisation bei.
Nachhaltige psychologische Sicherheit entsteht durch die Verbindung von Struktur und Resonanz:
Hierarchien, die Orientierung geben, ohne Abhängigkeit zu verstärken.
Rollen, die Partizipation ermöglichen.
Beziehungen, die Vertrauen fördern.
Systemisch-fundierte Formate wie Aufstellungen oder Werte-Workshops machen sichtbar, wo unbewusste Dynamiken wirken – etwa verdeckte Machtverhältnisse oder ungeklärte Übergänge in der Führung.
Ich erinnere mich an einen Geschäftsführer, der sich zwischen Loslassen und Kontrollbedürfnis hin- und hergerissen fühlte. Erst in der Aufstellung wurde sichtbar, dass die strukturelle Unklarheit seine psychologische Sicherheit unterlief – und damit auch die der Nachfolgegeneration.
Was Teams stärkt
Coachings und Teamformate unterstützen Führungskräfte, innere Klärung zu finden und Widerstände frühzeitig zu erkennen.
Hilfreich ist z. B. das Modell von Timothy Clark, das vier Stufen psychologischer Sicherheit beschreibt:
- Zugehörigkeitssicherheit – Ich darf dabei sein.
- Lernsicherheit – Ich darf Fragen stellen.
- Beitragssicherheit – Ich darf etwas bewirken.
- Herausforderungssicherheit – Ich darf Neues wagen.
Gezielte Reflexionsfragen helfen, diese Dimensionen lebendig zu halten:
- Wie sicher fühlen wir uns, offen zu lernen?
- Wie selbstverständlich ist es, Fehler anzusprechen?
- Welche Rituale stärken unser Zugehörigkeitsgefühl?
Ein Missverständnis hält sich hartnäckig: Psychologische Sicherheit bedeute Harmonie oder Konsens.
Das Gegenteil ist der Fall.
Dort, wo Widerspruch möglich ist, entsteht Innovation.
Wo Reibung angstfrei bleibt, wächst Kreativität.
Der Mut zur Tiefe
Psychologische Sicherheit ist kein Wohlfühlkonzept.
Sie ist ein Entwicklungsprinzip.
Sie fordert uns auf, hinzusehen, Widersprüche auszuhalten und Beziehung neu zu gestalten. Wenn Reibung ohne Angst möglich ist, entsteht eine Diskussionskultur, in der unterschiedliche Perspektiven zum Innovationsimpuls
werden.
Wer also Organisationen weiterentwickeln möchte, braucht die Bereitschaft hinzusehen und sich auf tieferer Ebene auseinanderzusetzen.
Der Mut zur psychodynamischen Tiefe unterscheidet nachhaltige Organisationsentwicklung von oberflächlichen Maßnahmen. Wer lebendige
Beziehungen zwischen Menschen und Organisation
gestalten will, muss bereit sein, unter die Oberfläche
zu schauen.
Denn dort liegen die Schätze verborgen, die Teams lebendig machen und Organisationen wandlungsfähig.
Dieser Artikel ist in ähnlicher Form in der Fachzeitschrift: Arbeit und Arbeitsrecht AuA 10/25 online erschienen.
Hier finden Sie das Interview in der Online-Version bei AuA.
https://www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/fachmagazin/fachartikel/mut-zur-veraenderung.html
Im Fachmagazin ist darüber hinaus noch der Safty-Scan nach Amy Edmondson veröffentlich. Wenn Sie interessiert sind, sende ich Ihnen den Safty-Scan gerne als White-Paper zu. Alternativ finden Sie hier den gesamten Artikel als PDF.
Hier finden Sie einen kurzen Impuls auf Linkedin dazu.
Bei Fragen oder Beratungsbedarf für Ihre konkrete Situation, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.
Vielen Dank.
Coaching

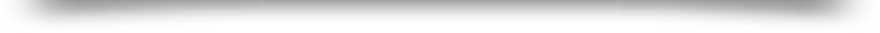
Coaching kann als professionelle Begleitung und Beratung für ManagerInnen, Führungskräfte
und MitarbeiterInnen im Berufsalltag betrachtet werden. Nutzen Sie die Beratung im Kontext von
Person, Rolle, Gruppe oder Organisation, um Klarheit, Orientierung und Handlungsoptionen
zu erhalten.
Training

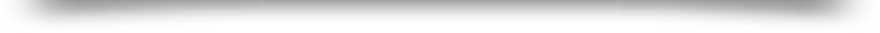
Selbstlernen gewinnt in einer sich dynamisch veränderten Wirtschaft-, Arbeits- und Technologiestruktur an Bedeutung. Zur Förderung eignen sich lebendige Methoden, in denen Führungskräfte und MItarbeiterInnen praxisnah und anwendungsorientiert ihren Lernprozess selbstverantwortlich steuern können.
Organisationsentwicklung

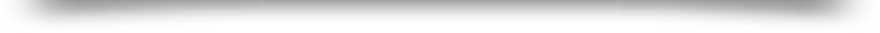
Organisationen unterliegen einem ständigen Wandel. Vielfältige Anforderungen des Marktes erfordern schnelle und flexible Handlungen der Unternehmen und Institutionen, die es erfolgreich zu gestalten gilt. Neben strukturellen und prozesshaften Veränderungen bedarf es eines besonderen Blickes auf das soziale Gefüge.
